
Interkulturelle Kompetenz beginnt mit Respekt.

Warum Sie diesen Artikel lesen sollten:
Die Deutschen bringen es gern auf den Punkt und wirken damit oft überhastet. Wer das weiß, sein eigenes Verhalten hinterfragt und die Bedürfnisse des Gegenübers kennt, meistert auch interkulturelle Herausforderungen. Im Folgenden finden Sie Hinweise, wie Sie sensibler mit anderen Vorstellungen von adäquatem Verhalten umgehen.
Die Amerikaner:innen pflegen den Small Talk. Personen aus Japan und China setzen bei ihren Beziehungen auf den persönlichen Kontakt und wollen mit ihren Geschäftspartner:innen möglichst viel Zeit verbringen. Bei den Schweizer:innen gehört eine fast schon übertriebene Höflichkeit im Umgang mit Geschäftspartner:innen zum guten Ton.
Andere Länder, andere Sitten: Kluge Unternehmen berücksichtigen die kulturellen Unterschiede bei ihrer Expansion über die Grenzen. „Die Deutschen gehen tendenziell bei ihren Akquisegesprächen im Ausland zu direkt vor“, sagt Rainer Beekes, Managing Partner bei Global Cultures – Akademie für interkulturelles Management Beekes & Beekes GbR. „Während es bei uns eher üblich ist, gleich kurz und knapp das eigene Anliegen zu formulieren, wollen andere Nationalitäten ihre Geschäftspartner:innen erst einmal richtig kennenlernen.“

Managing Partner bei Global Cultures – Akademie für interkulturelles Management Beekes & Beekes, GbR
Ein bisschen Zurückhaltung in der Kommunikation sowie Reflexion über die Bedürfnisse des Gegenübers sind also angebracht. Beekes rät dazu, dem Dialog viel mehr Raum zu geben als hierzulande üblich. Meetings dienen im Ausland häufig weniger dazu, schnell zur Entscheidung oder womöglich zum Abschluss zu kommen. Vielmehr geht es um den Gedankenaustausch und das Miteinander.
„Das sollte man nicht als pure Zeitverschwendung sehen, sondern als große Chance, Markteintrittsbarrieren abzubauen“, meint Beekes.
Englisch ist Pflicht – oder qualifizierte Dolmetscher:innen.
Am besten dürfte das in der jeweiligen Landessprache gelingen. „Englisch gilt international inzwischen als Muss. Französisch wird nicht immer erwartet. Sicherlich ist es nicht von Nachteil, wenn Unternehmen auch hier etwas zu bieten haben“, so Beekes.
Dolmetscher:innen dürften bei Beziehungen nach Osteuropa, Asien oder Afrika gefragt sein. „Aber prüfe, wer sich bindet“, warnt Beekes. Tipp: Unternehmen sollten sich Referenzen zeigen lassen. Dolmetscher:innen sollten die Fachbegriffe der Branche kennen. Und gegenseitiges Vertrauen bildet immer die Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Schließlich kann ein falscher Zungenschlag in der Übersetzung das ganze Geschäft platzen lassen.

Wichtig: Fettnäpfchen vermeiden.
So können Sie sich fit machen für die Besonderheiten Ihrer neuen Zielmärkte:
Eigene Recherche: Das Internet sowie die Literatur bieten zahlreiche Informationen zum Verhaltenskodex im Ausland, sei es in der EU, in Asien oder Afrika.
Erfahrene Kolleg:innen fragen: Der Freund eines Freundes hat zwei Nationalitäten und dessen Familie lebt noch im anderen Land? Dann haben Sie den idealen Einstieg, um aus berufenem Munde Erfahrungen zu sammeln.
An Seminaren teilnehmen: Selbst wer meint, er kenne sich im Ausland schon gut aus: Jeder kann noch dazulernen. Spezifisches Wissen vermitteln interkulturelle Seminare und erfahrene Berater:innen.
Gallerie: Interkulturelle Kompetenz.
Andere Länder, andere Business-Regeln. Der Kontakt mit fremden Kulturen steckt bisweilen voller Überraschungen. Für gute Geschäftsbeziehungen sollten Sie wissen, wie man interkulturelle Fettnäpfchen umgeht.

Die Grafik zeigt zentral den Schriftzug „Interkulturelle Kompetenz“ in großer türkisfarbener Schrift, darunter den Untertitel „So umgehen Sie interkulturelle Fettnäpfchen“. Im Hintergrund ist dezent eine graue Weltkarte abgebildet, die flächendeckend über das gesamte Bild reicht. Es handelt sich um ein reines Titelbild ohne weitere Inhalte oder Daten.

Die Grafik zeigt eine stilisierte Weltkarte in Grautönen. Der Kontinent Afrika ist farblich hervorgehoben. Links neben der Karte steht in großer Schrift das Wort „Afrika“. Andere Kontinente sind nur angedeutet und nicht beschriftet.
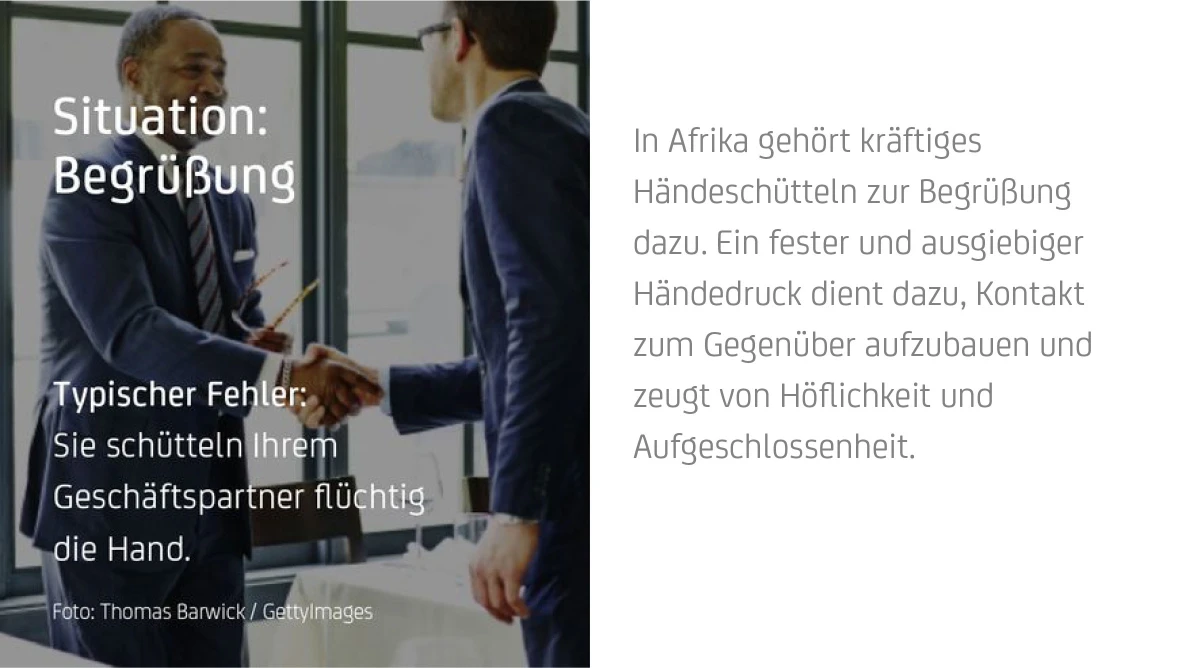
Die Grafik ist zweigeteilt. Links zeigt ein Foto zwei Personen in Anzügen beim Händeschütteln. Darüber steht: „Situation: Begrüßung“. Darunter folgt der Hinweis: „Typischer Fehler: Sie schütteln Ihrem Geschäftspartner flüchtig die Hand.“ Rechts auf weißem Hintergrund steht: „In Afrika gehört kräftiges Händeschütteln zur Begrüßung dazu. Ein fester und ausgiebiger Händedruck dient dazu, Kontakt zum Gegenüber aufzubauen und zeugt von Höflichkeit und Aufgeschlossenheit.“ Die Bildquelle ist: „Foto: Thomas Barwick / GettyImages“.
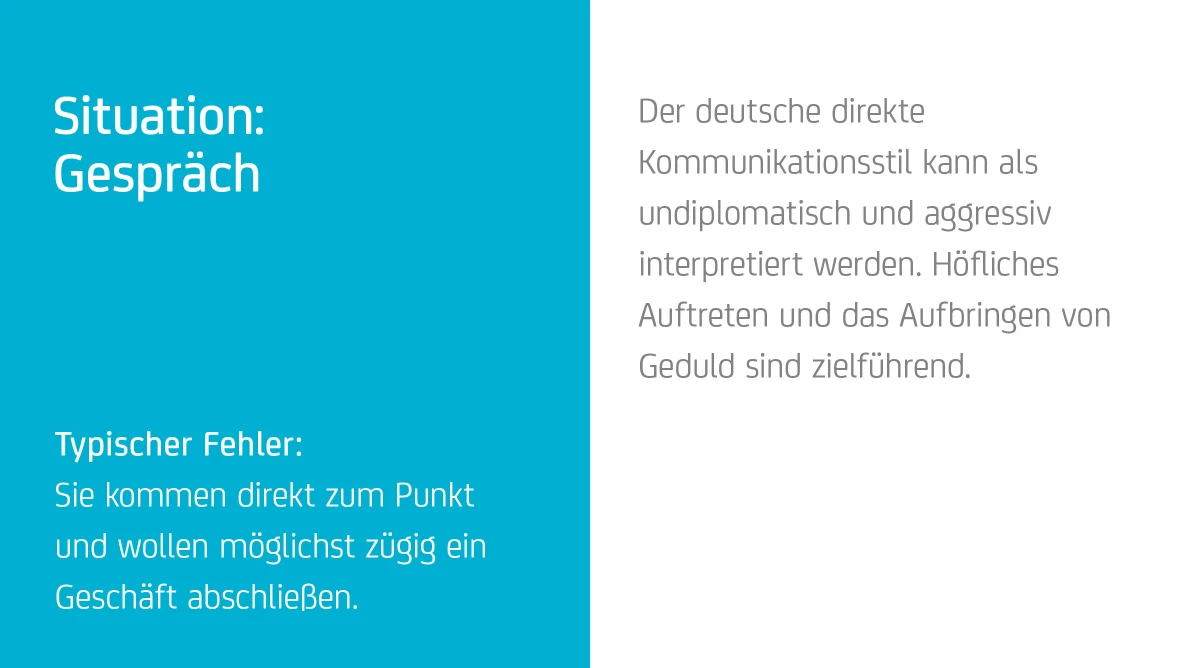
Die Grafik ist zweigeteilt. Links auf blauem Hintergrund steht: „Situation: Gespräch“. Darunter folgt: „Typischer Fehler: Sie kommen direkt zum Punkt und wollen möglichst zügig ein Geschäft abschließen.“ Rechts auf weißem Hintergrund steht: „Der deutsche direkte Kommunikationsstil kann als undiplomatisch und aggressiv interpretiert werden. Höfliches Auftreten und das Aufbringen von Geduld sind zielführend.“ Es sind keine bildlichen oder grafischen Elemente außer dem kleinen Flaggenelement in den bulgarischen Farben (weiß-grün-rot) zu sehen.
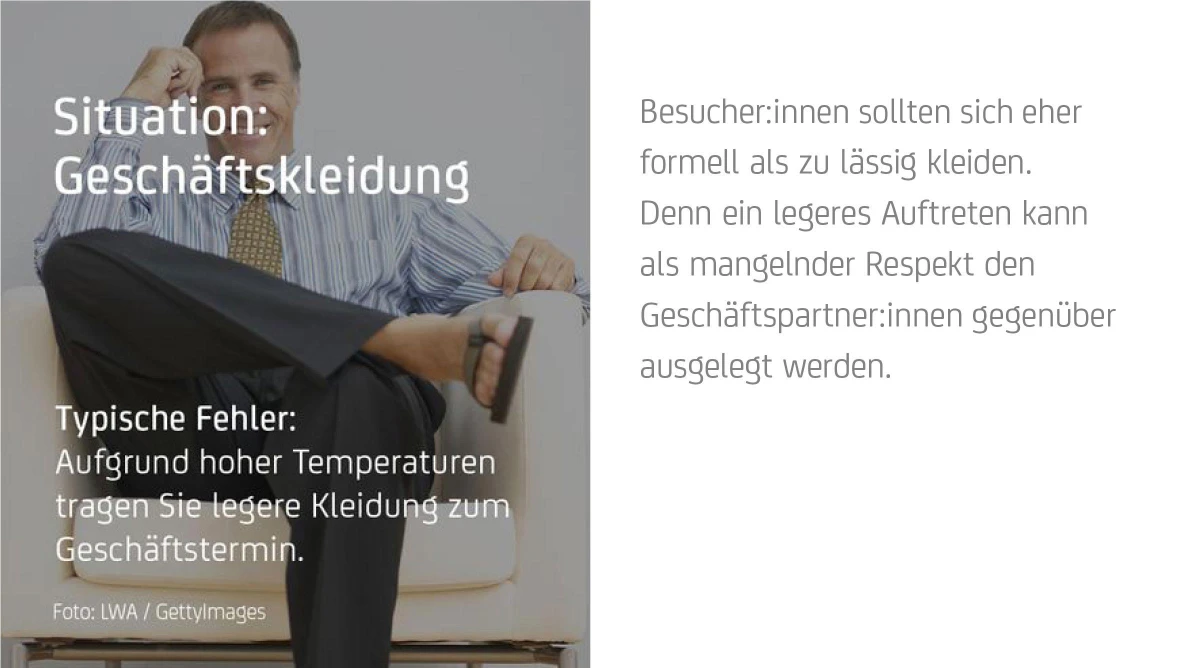
Die Grafik ist zweigeteilt. Links zeigt ein Foto eine Person im gestreiften Hemd und mit lockerer Haltung auf einem Stuhl. Darüber steht: „Situation: Geschäftskleidung“. Darunter folgt: „Typische Fehler: Aufgrund hoher Temperaturen tragen Sie legere Kleidung zum Geschäftstermin.“ Rechts auf weißem Hintergrund steht: „Besucher:innen sollten sich eher formell als zu lässig kleiden. Denn ein legeres Auftreten kann als mangelnder Respekt den Geschäftspartner:innen gegenüber ausgelegt werden.“ Bildquelle: „Foto: LWA / GettyImages“.
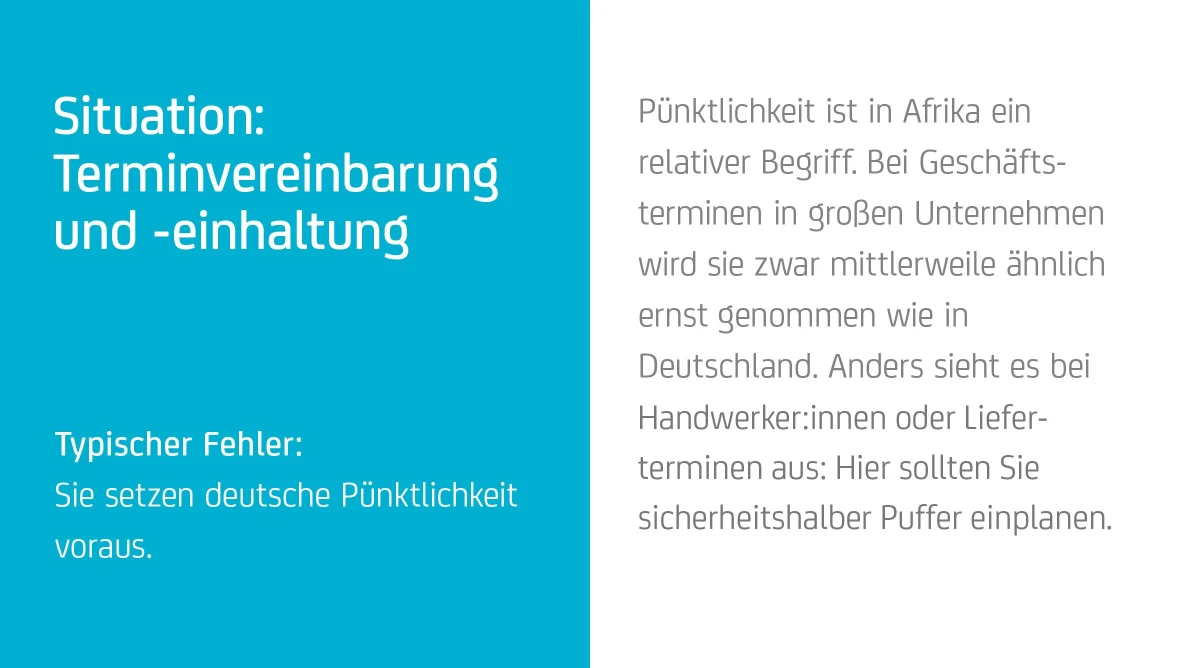
Die Grafik ist zweigeteilt. Links auf blauem Hintergrund steht: „Situation: Terminvereinbarung und -einhaltung“. Darunter folgt: „Typischer Fehler: Sie setzen deutsche Pünktlichkeit voraus.“ Rechts auf weißem Hintergrund steht: „Pünktlichkeit ist in Afrika ein relativer Begriff. Bei Geschäftsterminen in großen Unternehmen wird sie zwar mittlerweile ähnlich ernst genommen wie in Deutschland. Anders sieht es bei Handwerker:innen oder Lieferterminen aus: Hier sollten Sie sicherheitshalber Puffer einplanen.“
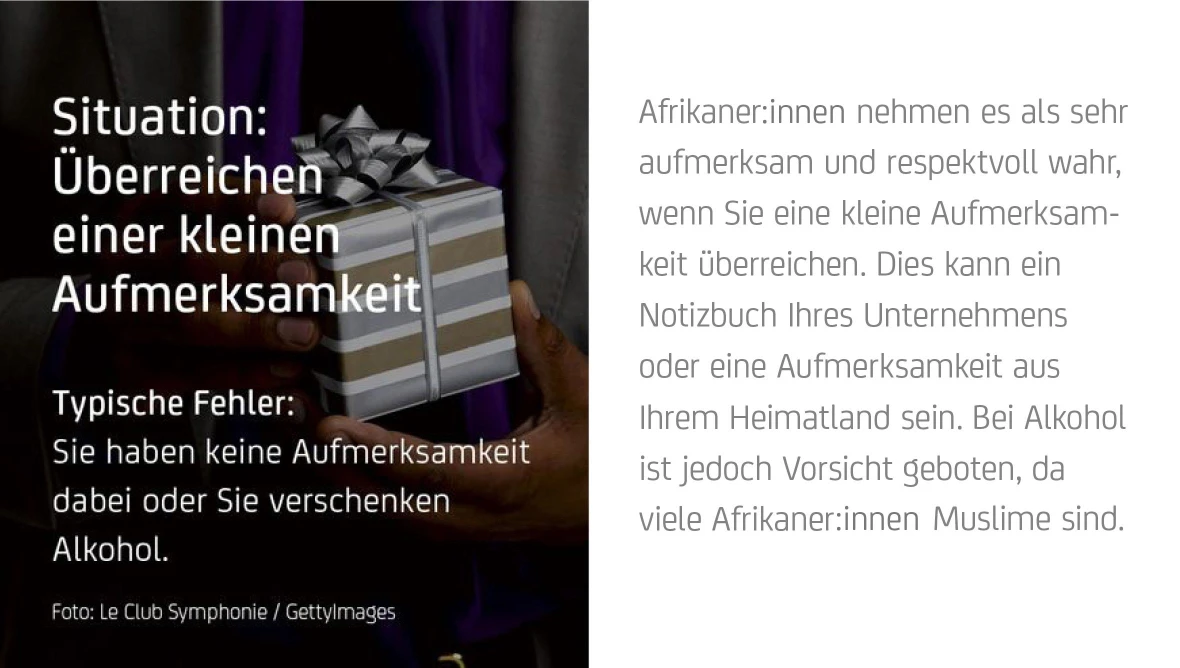
Die Grafik ist zweigeteilt. Links zeigt ein Foto eine Person, die ein silbern verpacktes Geschenk mit Schleife überreicht. Darüber steht: „Situation: Überreichen einer kleinen Aufmerksamkeit“. Darunter folgt: „Typische Fehler: Sie haben keine Aufmerksamkeit dabei oder Sie verschenken Alkohol.“ Rechts auf weißem Hintergrund steht: „Afrikaner:innen nehmen es als sehr aufmerksam und respektvoll wahr, wenn Sie eine kleine Aufmerksamkeit überreichen. Dies kann ein Notizbuch Ihres Unternehmens oder eine Aufmerksamkeit aus Ihrem Heimatland sein. Bei Alkohol ist jedoch Vorsicht geboten, da viele Afrikaner:innen Muslime sind.“ Bildquelle: „Foto: Le Club Symphonie / GettyImages“.

Die Grafik zeigt eine stilisierte Weltkarte in Grautönen. Japan ist farblich hervorgehoben. Links neben der Karte steht in großer Schrift das Wort „Japan“. In der oberen rechten Ecke ist ein kleines rotes Kreissymbol abgebildet, das die Nationalflagge Japans andeutet. Andere Länder und Kontinente sind nicht beschriftet.

Die Grafik ist zweigeteilt. Links zeigt ein Foto zwei Personen im Anzug beim Austausch von Visitenkarten, beide mit leicht gebeugter Haltung. Darüber steht: „Situation: Visitenkarten“. Darunter folgt: „Typischer Fehler: Sie überreichen keine Visitenkarte, oder haben nicht einmal eine dabei.“ Rechts auf weißem Hintergrund steht: „Der Austausch von Visitenkarten beim ersten Kontakt ist außerordentlich wichtig. Die Karten sollten nicht lose in der Hemd- oder Hosentasche, sondern in einem repräsentativen Etui stecken. Bis zum Gesprächsende lässt man erhaltene Visitenkarten der Sitzordnung entsprechend vor sich auf dem Tisch liegen, um jederzeit den Namen und Titel des Gegenübers nachlesen zu können.“ Bildquelle: „Foto: Dave & Les Jacobs / GettyImages“. In der oberen rechten Ecke ist ein kleiner roter Punkt abgebildet, der die japanische Flagge symbolisiert.
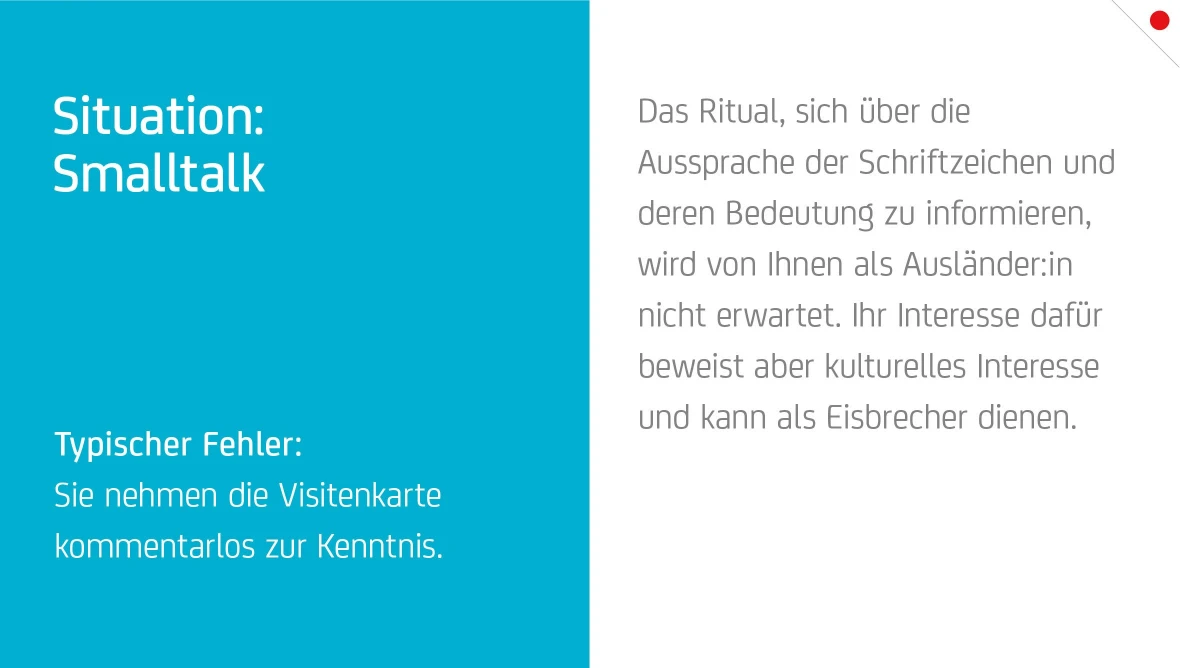
Die Grafik ist zweigeteilt: Auf der linken Seite mit blauem Hintergrund steht der Titel „Situation: Smalltalk“ sowie der Hinweis „Typischer Fehler: Sie nehmen die Visitenkarte kommentarlos zur Kenntnis.“ Die rechte Seite auf weißem Hintergrund erläutert, dass das Interesse an der Aussprache und Bedeutung von Schriftzeichen nicht erwartet wird, aber als Zeichen kulturellen Interesses gilt und als Gesprächseinstieg („Eisbrecher“) dienen kann. In der oberen rechten Ecke ist ein kleiner roter Punkt mit angedeuteter weißer Ecke zu sehen, der möglicherweise auf Japan verweist. Die Grafik vermittelt interkulturelles Wissen über den angemessenen Umgang mit Visitenkarten.
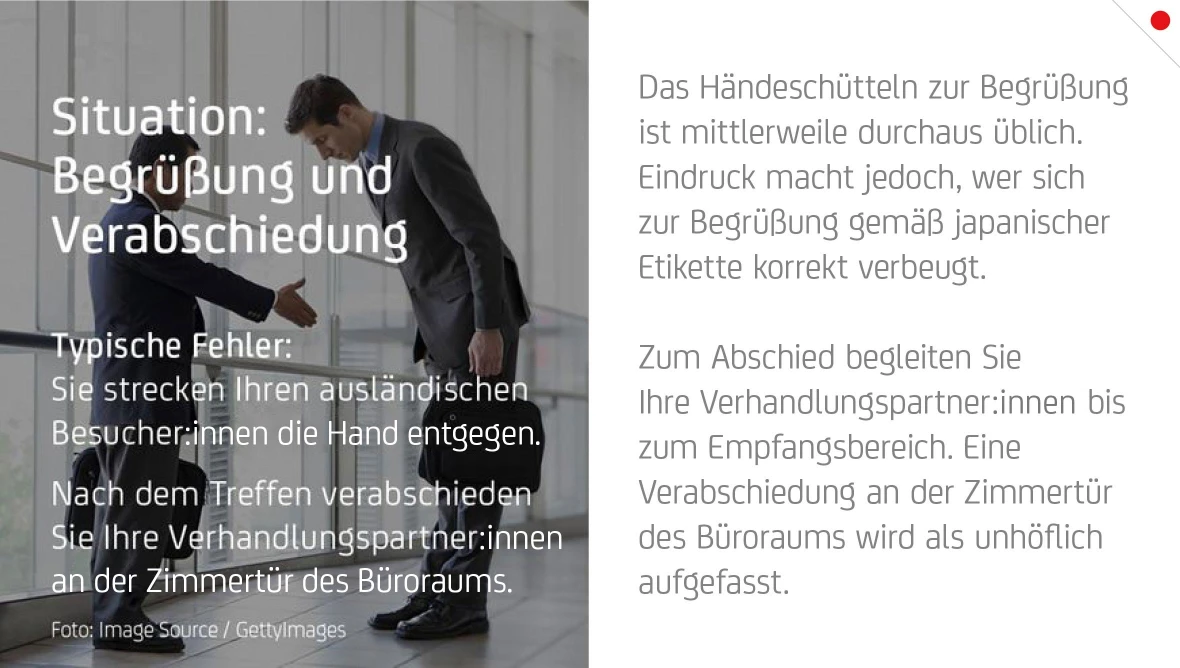
Die Grafik ist in zwei Hälften aufgeteilt. Links zeigt ein Foto zwei Männer im Anzug bei der Begrüßung, einer davon verbeugt sich, während der andere ihm die Hand entgegenstreckt. Darüber steht der Titel: „Situation: Begrüßung und Verabschiedung“. Darunter werden typische Fehler genannt: Ausländischen Gästen wird automatisch die Hand gereicht und sie werden nur bis zur Zimmertür verabschiedet. Die rechte Seite auf weißem Hintergrund enthält Erläuterungen: Zwar sei Händeschütteln mittlerweile üblich, Eindruck mache jedoch, wer sich zur Begrüßung nach japanischer Etikette korrekt verbeugt. Zudem wird empfohlen, internationale Verhandlungspartner:innen zum Empfangsbereich zu begleiten, da eine Verabschiedung an der Tür als unhöflich gilt. In der rechten oberen Ecke ist ein kleiner roter Punkt zu sehen, der auf Japan hindeuten kann.

Die Grafik ist zweigeteilt. Auf der linken Seite mit türkisfarbenem Hintergrund steht der Titel „Situation: Im Restaurant“ sowie der Hinweis: „Typischer Fehler: Sie gehen direkt zu Ihrem Tisch.“ Auf der rechten Seite mit weißem Hintergrund wird erläutert, dass es in japanischen Restaurants üblich ist, die Schuhe im Eingangsbereich oder vor dem leicht erhöhten Essbereich auszuziehen. Zudem wird erklärt, dass es in den Toiletten eigene Pantoffeln gibt, die ausschließlich dort und nicht im Restaurant getragen werden dürfen. In der oberen rechten Ecke befindet sich ein kleiner roter Punkt, ein kultureller Hinweis auf Japan.
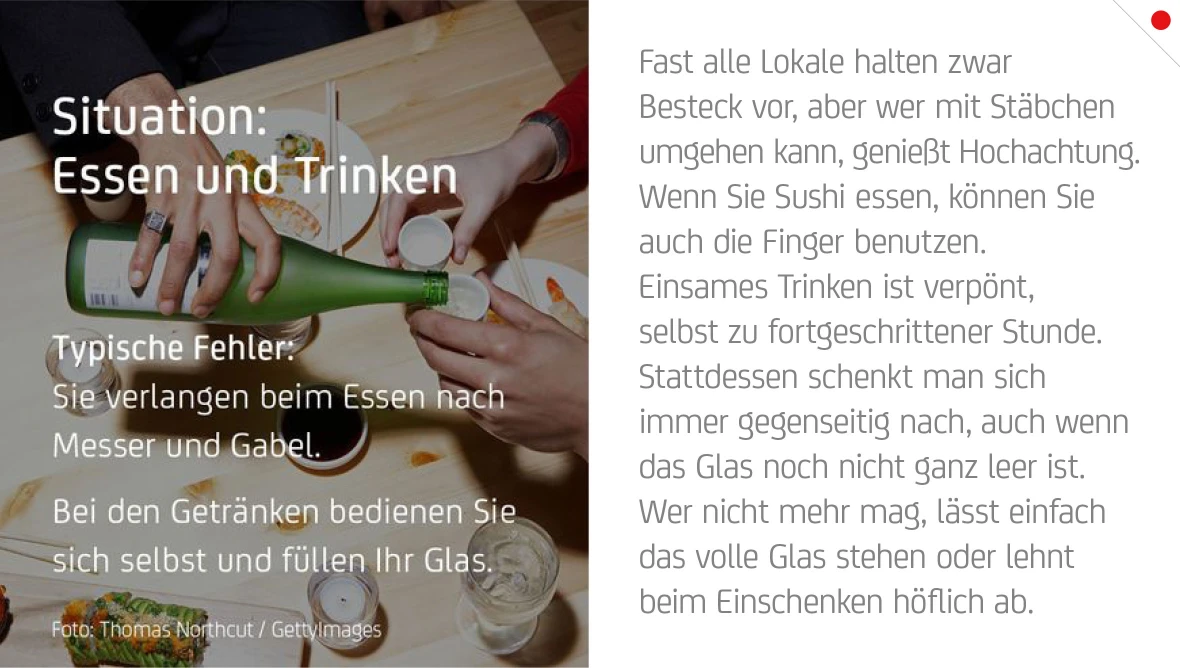
Die Grafik ist zweigeteilt. Auf der linken Seite befindet sich ein Foto, das eine Person beim Eingießen eines Getränks in ein Glas zeigt. Darüber steht der Titel: „Situation: Essen und Trinken“. Darunter werden zwei typische Fehler genannt: das Verlangen nach Messer und Gabel sowie das eigenständige Einschenken von Getränken. Die rechte Seite auf weißem Hintergrund liefert kulturelle Hinweise: Zwar bieten viele Lokale Besteck an, doch wer mit Stäbchen umgehen kann, wird besonders geschätzt. Beim Sushiessen dürfen auch die Finger verwendet werden. Allein zu trinken gilt als unhöflich – man schenkt sich gegenseitig nach, auch wenn das Glas noch nicht leer ist. Wer nichts mehr möchte, lässt sein Glas stehen oder lehnt freundlich ab. In der oberen rechten Ecke befindet sich ein kleiner roter Punkt, der auf den japanischen Kontext verweist.
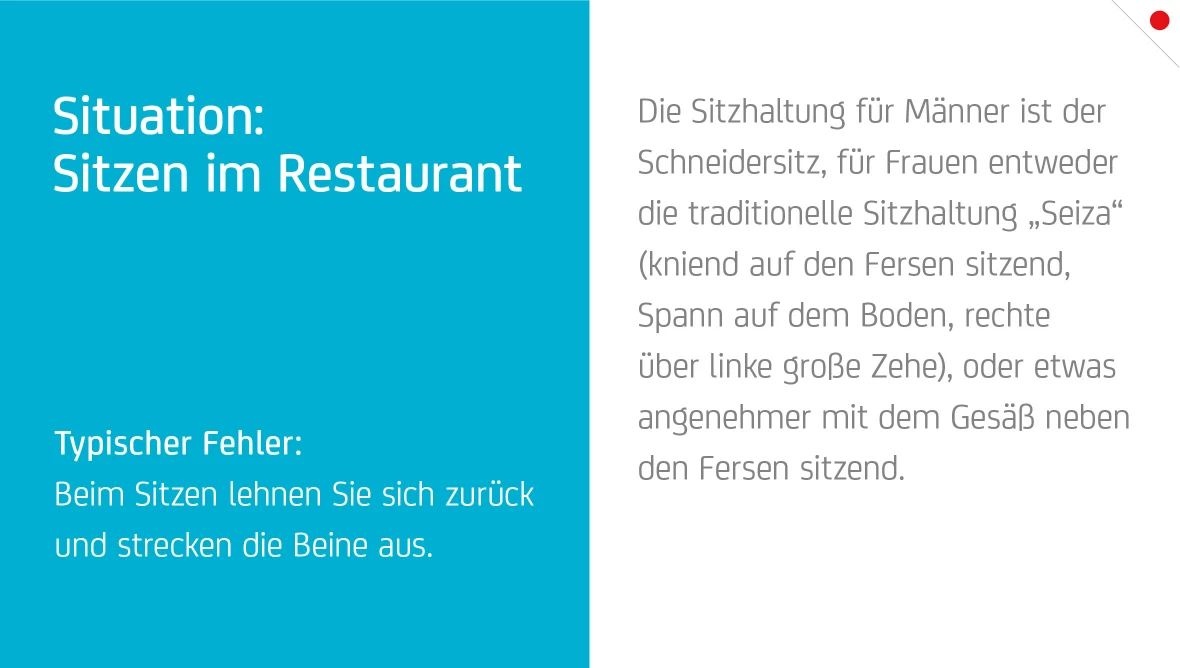
Die Grafik ist zweigeteilt. Links auf blauem Hintergrund steht: „Situation: Sitzen im Restaurant“. Darunter in Weiß hervorgehoben: „Typischer Fehler: Beim Sitzen lehnen Sie sich zurück und strecken die Beine aus.“ Rechts auf weißem Hintergrund befindet sich ein Textabschnitt, der korrektes Verhalten beschreibt: Männer sollen im Schneidersitz sitzen, Frauen entweder in traditioneller Seiza-Haltung (knieend auf den Fersen, Spann auf dem Boden, rechter Fuß über linkem großen Zeh) oder in einer Variante, bei der das Gesäß neben den Fersen ruht.

Die Grafik zeigt eine stilisierte Weltkarte in Grautönen. China ist in Blau hervorgehoben. Links neben der Karte steht groß das Wort „China“. In der oberen rechten Ecke befindet sich eine kleine chinesische Flagge. Weitere Länder sind nur angedeutet und nicht beschriftet.
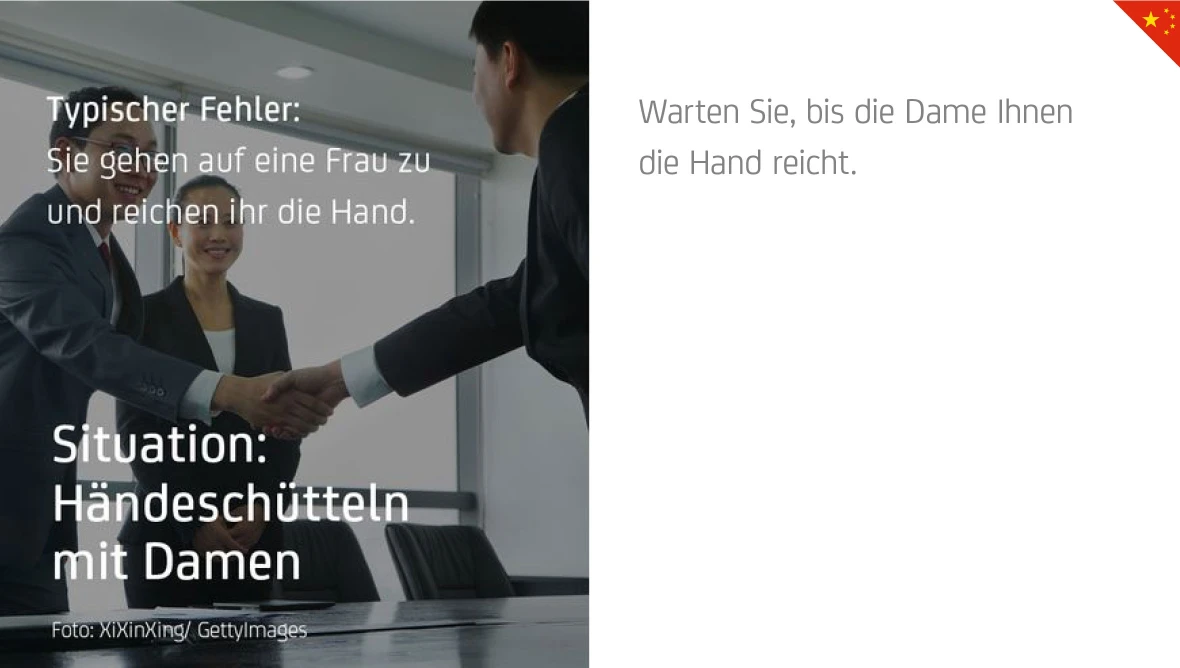
Die Grafik ist zweigeteilt. Links ist ein Foto von zwei Personen, die sich die Hand geben, mit einer Frau im Hintergrund. Darüber steht: „Typischer Fehler: Sie gehen auf eine Frau zu und reichen ihr die Hand.“ Darunter folgt der Hinweis: „Situation: Händeschütteln mit Damen“. Rechts auf weißem Hintergrund steht der Hinweis: „Warten Sie, bis die Dame Ihnen die Hand reicht.“ In der oberen rechten Ecke befindet sich eine kleine chinesische Flagge. Die Bildquelle ist angegeben: „Foto: XiXinXing / GettyImages“.
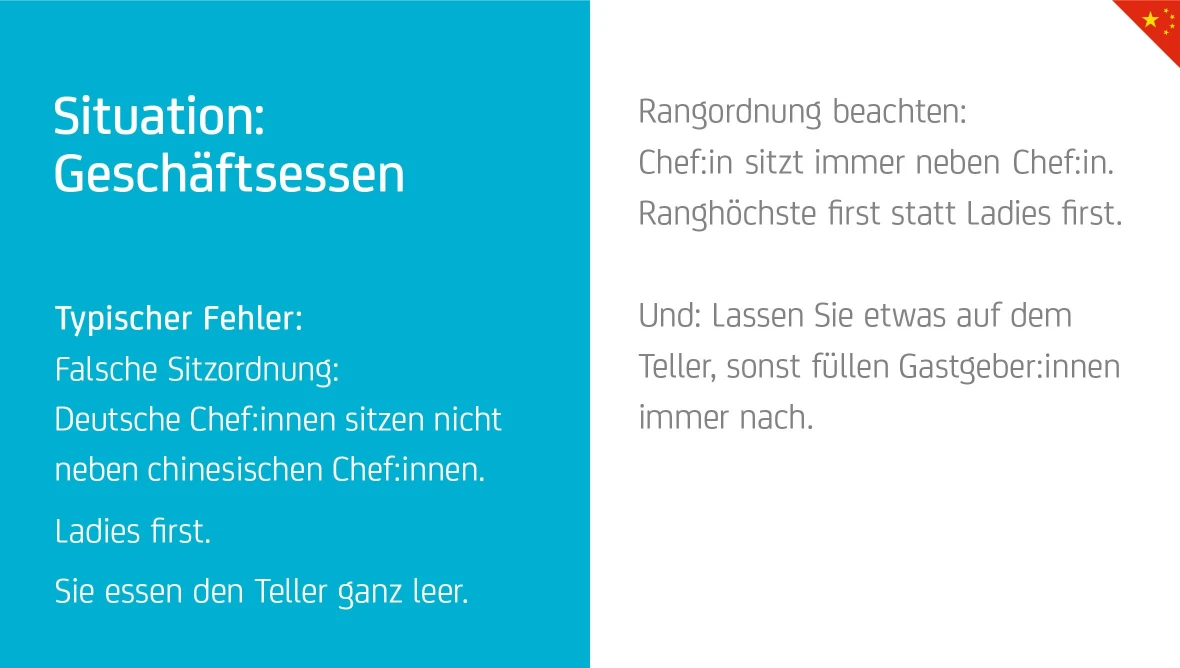
Die Grafik ist zweigeteilt. Links auf blauem Hintergrund steht: „Situation: Geschäftsessen“. Darunter folgen Hinweise auf typische Fehler: Deutsche Führungskräfte sitzen nicht neben chinesischen, es gilt „Ladies first“ und der Teller wird ganz leer gegessen. Rechts auf weißem Hintergrund steht die korrekte Vorgehensweise: Die Rangordnung ist entscheidend („Chef:in sitzt neben Chef:in“, „Ranghöchste first statt Ladies first“). Zudem soll etwas auf dem Teller übrig bleiben, da Gastgeber:innen sonst nachfüllen. In der oberen rechten Ecke befindet sich eine kleine chinesische Flagge.
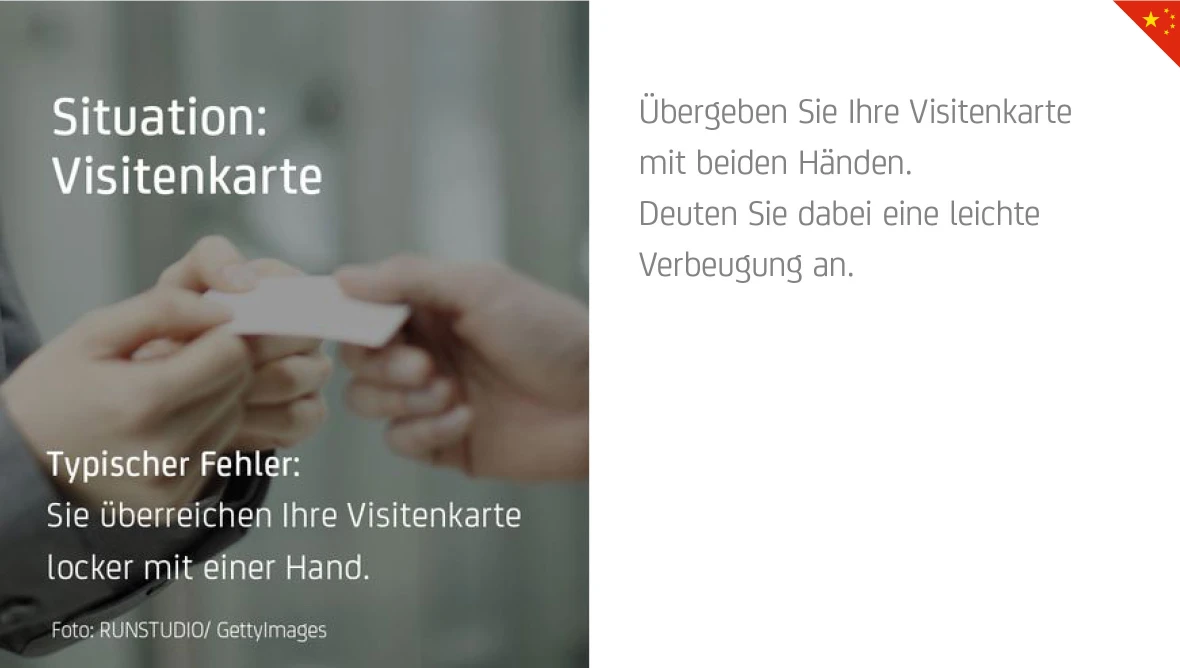
Die Grafik ist zweigeteilt. Links zeigt ein Foto zwei Personen, die sich gegenseitig eine Visitenkarte überreichen. Darüber steht: „Situation: Visitenkarte“. Darunter folgt der Hinweis „Typischer Fehler: Sie überreichen Ihre Visitenkarte locker mit einer Hand.“ Rechts auf weißem Hintergrund steht die korrekte Vorgehensweise: „Übergeben Sie Ihre Visitenkarte mit beiden Händen. Deuten Sie dabei eine leichte Verbeugung an.“ In der oberen rechten Ecke befindet sich eine kleine chinesische Flagge.
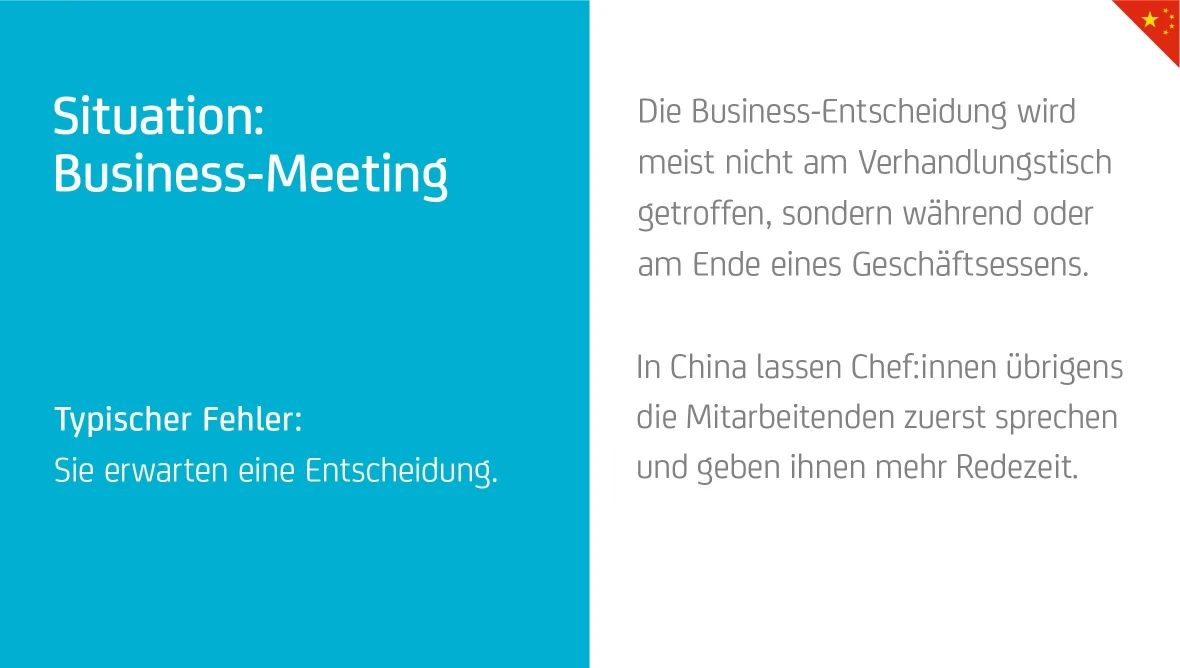
Die Grafik ist zweigeteilt. Links auf blauem Hintergrund steht: „Situation: Business-Meeting“. Darunter folgt der Hinweis „Typischer Fehler: Sie erwarten eine Entscheidung.“ Rechts auf weißem Hintergrund wird erklärt, dass Business-Entscheidungen in China meist nicht direkt am Verhandlungstisch, sondern während oder am Ende eines Geschäftsessens getroffen werden. Außerdem wird erwähnt, dass in China Führungspersonen Mitarbeitenden zuerst das Wort erteilen und ihnen mehr Redezeit geben. In der oberen rechten Ecke befindet sich eine kleine chinesische Flagge.
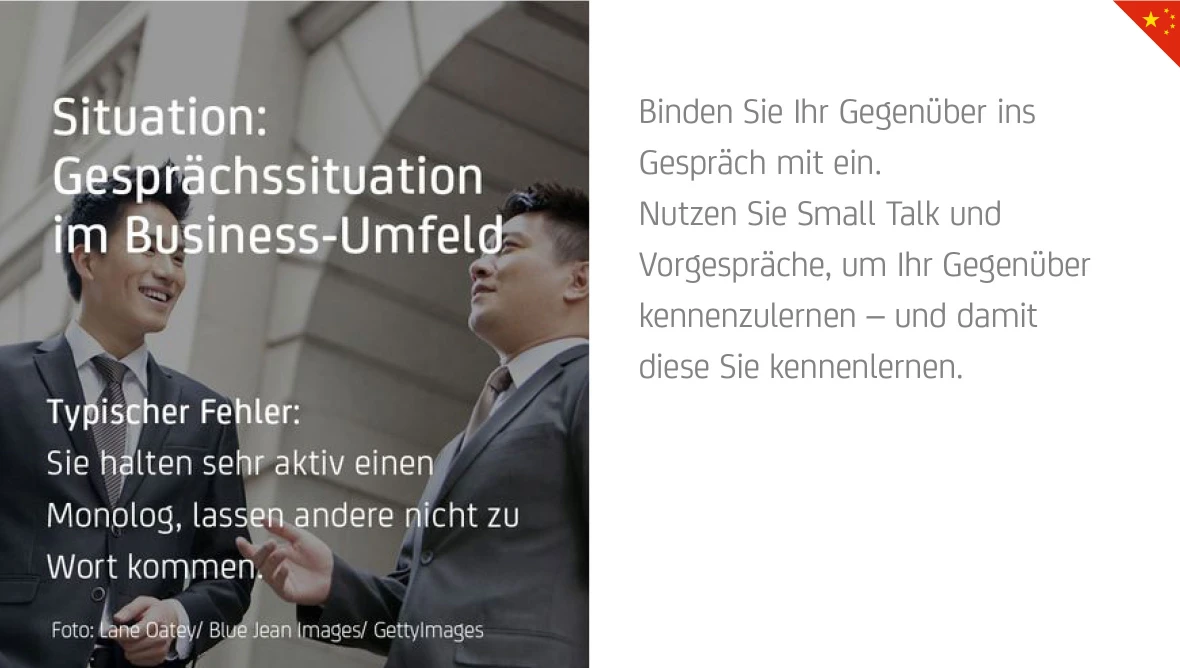
Die Grafik ist zweigeteilt. Links zeigt ein Foto zwei Personen im Anzug, die sich im Gespräch befinden. Darüber steht: „Situation: Gesprächssituation im Business-Umfeld“. Darunter folgt: „Typischer Fehler: Sie halten sehr aktiv einen Monolog, lassen andere nicht zu Wort kommen.“ Rechts auf weißem Hintergrund steht die Empfehlung: „Binden Sie Ihr Gegenüber ins Gespräch mit ein. Nutzen Sie Small Talk und Vorgespräche, um Ihr Gegenüber kennenzulernen – und damit diese Sie kennenlernen.“ In der oberen rechten Ecke befindet sich eine kleine chinesische Flagge.
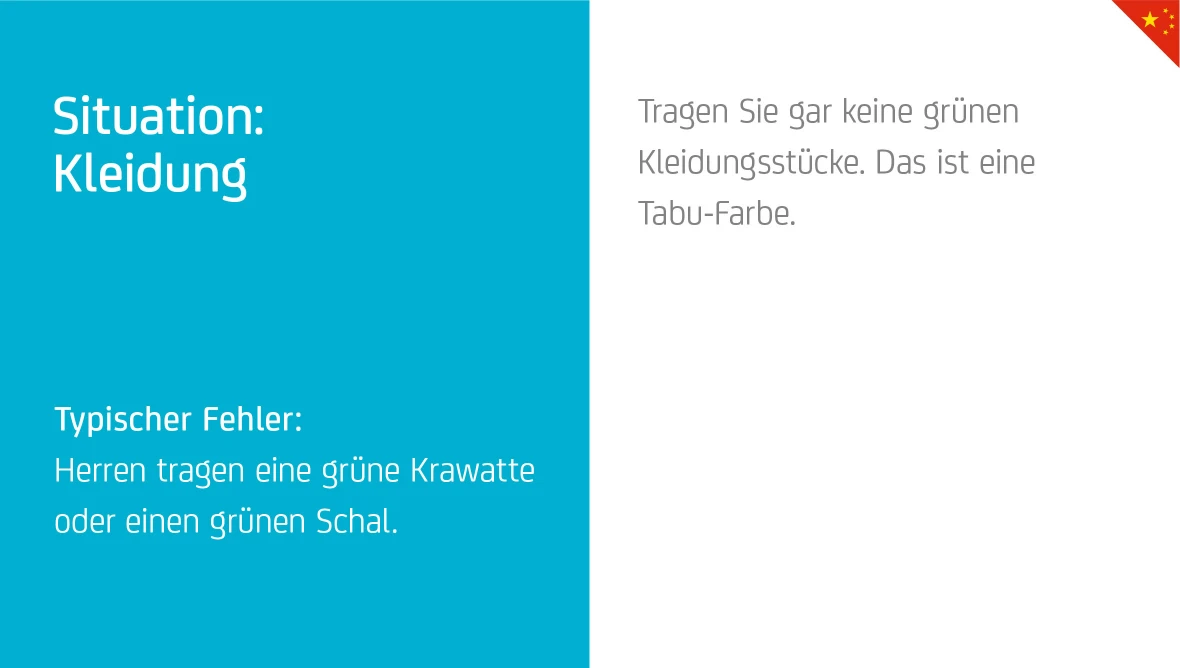
Die Grafik ist zweigeteilt. Links auf blauem Hintergrund steht: „Situation: Kleidung“. Darunter folgt: „Typischer Fehler: Herren tragen eine grüne Krawatte oder einen grünen Schal.“ Rechts auf weißem Hintergrund befindet sich der Hinweis: „Tragen Sie gar keine grünen Kleidungsstücke. Das ist eine Tabu-Farbe.“ In der oberen rechten Ecke befindet sich eine kleine chinesische Flagge.

Die Grafik zeigt eine stilisierte Weltkarte in Grautönen. Bulgarien ist farblich hervorgehoben. Links neben der Karte steht in großer Schrift das Wort „Bulgarien“. In der oberen rechten Ecke ist ein kleines Ecksymbol in den Farben der bulgarischen Flagge (weiß-grün-rot) zu sehen. Weitere Länder sind nicht beschriftet.
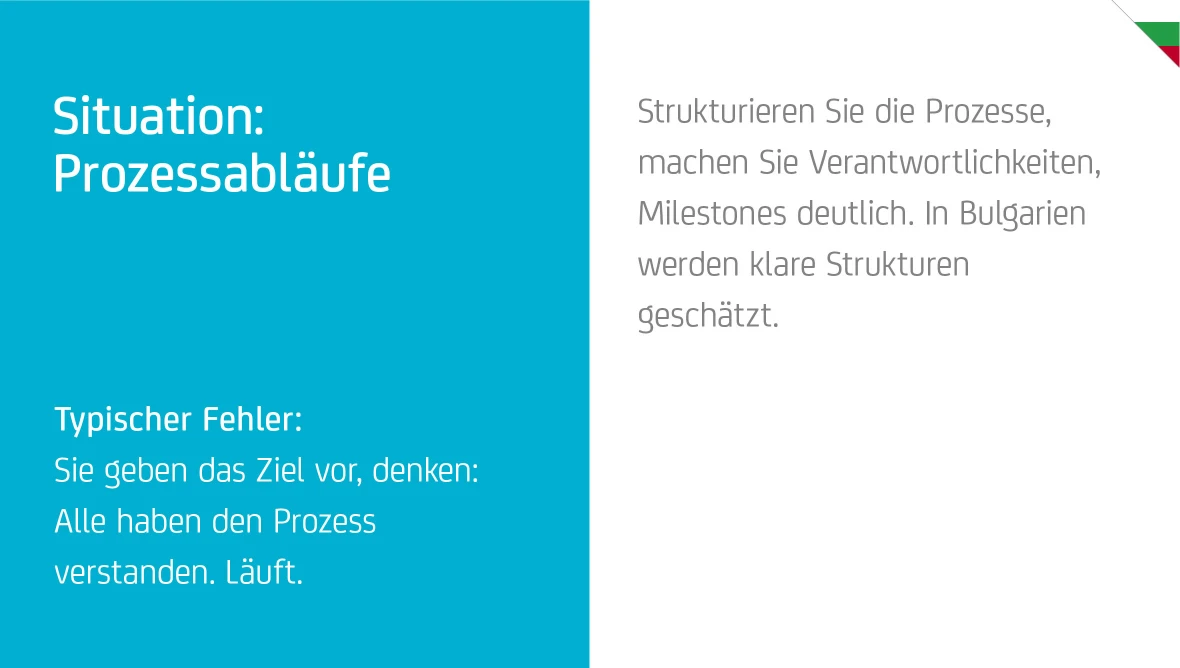
Die Grafik ist zweigeteilt. Links auf blauem Hintergrund steht: „Situation: Prozessabläufe“. Darunter folgt der Hinweis: „Typischer Fehler: Sie geben das Ziel vor, denken: Alle haben den Prozess verstanden. Läuft.“ Rechts auf weißem Hintergrund steht: „Strukturieren Sie die Prozesse, machen Sie Verantwortlichkeiten, Milestones deutlich. In Bulgarien werden klare Strukturen geschätzt.“ In der oberen rechten Ecke befindet sich ein kleines Ecksymbol in den Farben der bulgarischen Flagge (weiß-grün-rot).
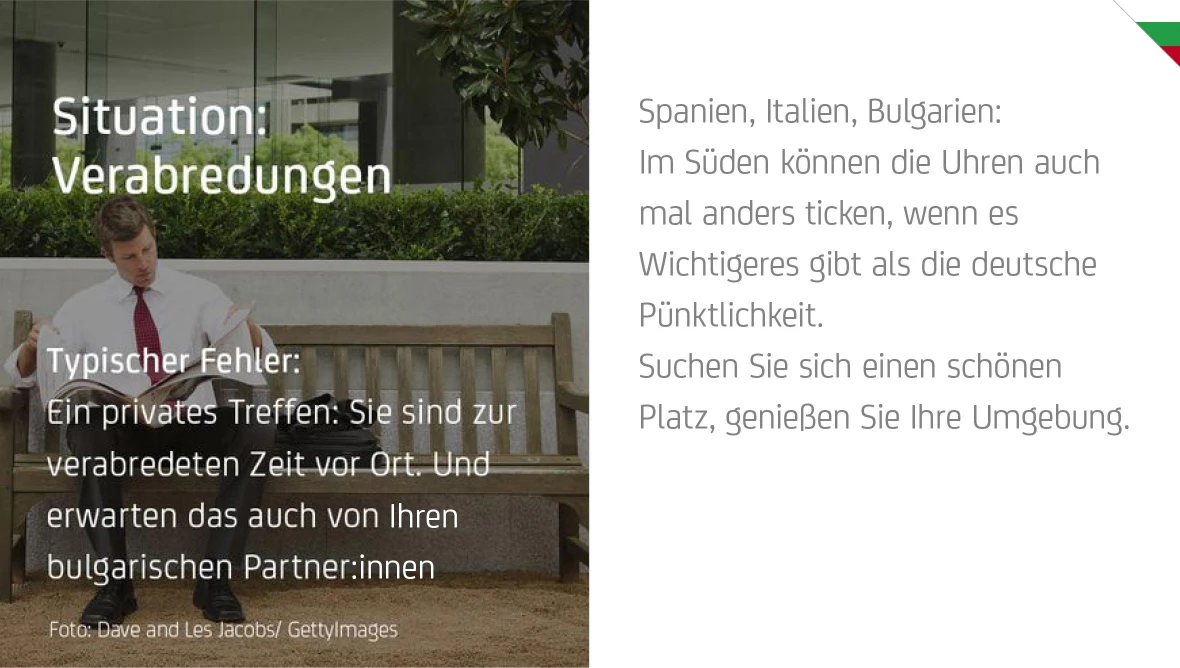
Die Grafik ist zweigeteilt. Links zeigt ein Foto eine Person im Anzug, die auf einer Parkbank sitzt und in einer Zeitung liest. Darüber steht: „Situation: Verabredungen“. Darunter folgt: „Typischer Fehler: Ein privates Treffen: Sie sind zur verabredeten Zeit vor Ort. Und erwarten das auch von Ihren bulgarischen Partner:innen.“ Rechts auf weißem Hintergrund steht: „Spanien, Italien, Bulgarien: Im Süden können die Uhren auch mal anders ticken, wenn es Wichtigeres gibt als die deutsche Pünktlichkeit. Suchen Sie sich einen schönen Platz, genießen Sie Ihre Umgebung.“ In der oberen rechten Ecke ist ein kleines Ecksymbol in den Farben der bulgarischen Flagge zu sehen.
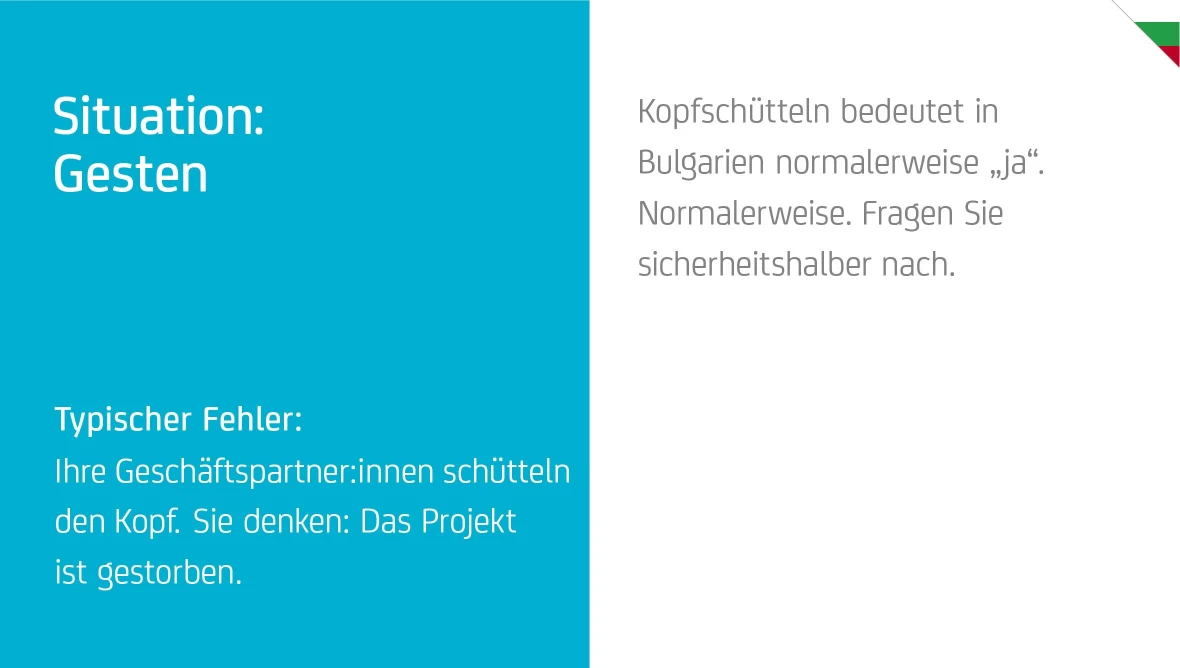
Die Grafik ist zweigeteilt. Links auf blauem Hintergrund steht: „Situation: Gesten“. Darunter folgt: „Typischer Fehler: Ihre Geschäftspartner:innen schütteln den Kopf. Sie denken: Das Projekt ist gestorben.“ Rechts auf weißem Hintergrund steht: „Kopfschütteln bedeutet in Bulgarien normalerweise ‚ja‘. Normalerweise. Fragen Sie sicherheitshalber nach.“ In der oberen rechten Ecke befindet sich ein kleines Ecksymbol in den Farben der bulgarischen Flagge (weiß-grün-rot).
Verständnis zeigen für andere Kulturen.
Überdies ist Zurückhaltung die Kür: Made in Germany steht im Ausland noch immer für Qualität und Service. Pünklichkeit gilt als urdeutsche Tugend. „Das gute Image bezieht sich aber allein auf die Technik“, meint Beekes. Die Deutschen haben das Image, zuverlässig, fleißig und ehrlich zu sein, genauso aber auch pedantisch, rechthaberisch, wenig humorvoll und unflexibel.
Sein Tipp: „Zeigen Sie Verständnis für andere Kulturen!“ Der Experte warnt davor, sich in deutscher Manie als etwas Besseres zu fühlen.
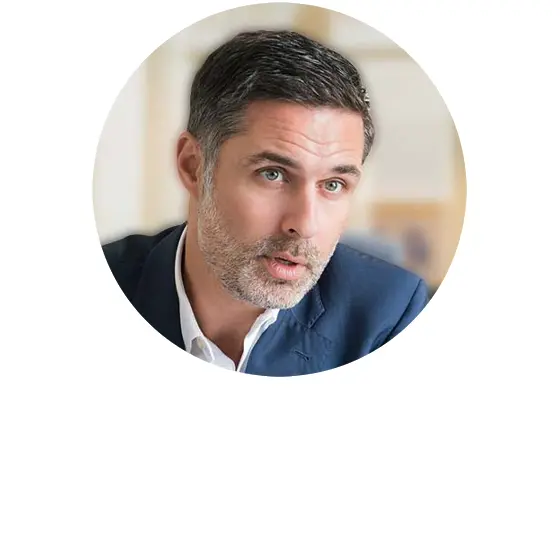
Sie möchten mehr über Auslandszahlungsverkehr erfahren?
Vielmehr geben sich clevere Unternehmen gegenüber ihren Gesprächspartner:innen unvoreingenommen und offen. Sie hören zu, achten auf Gesten. „Mimik und Körpersprache vermitteln den Löwenanteil der Nachricht. Dem gesprochenen Wort kommt die geringste Bedeutung zu“, erläutert Beekes. Heißt: Die Botschaft liegt nicht in der jeweiligen Aussage, sondern in der Art und Weise, wie man auftritt.
Deshalb ist es ratsam, sich den Gepflogenheiten und den Umgangsformen im anderen Land anzupassen. Wer unsicher ist, fragt nach und informiert sich vorab über die Usancen.
Mit Geschenken sensibel umgehen.
Experte Beekes erinnert sich an einen geschäftlichen Termin mit Taiwanesen vor mehreren Jahren. Ein Unternehmer wollte seine Kund:innen beeindrucken. Er brachte modische Uhren als kleines Präsent mit in ein Meeting.
Die unerwartete Reaktion: Die potenziellen Kund:innen zückten ihr Portemonnaie, um die Zeitmesser zu bezahlen. „Bekommt man eine Uhr geschenkt, bedeutet das: Deine Zeit läuft ab“, sagt Beekes.

Sechs Tipps für strategische Kommunikation!
So verhalten Sie sich im Ausland richtig:
Einen Schritt zurückgehen.
Erst einmal abwarten, bloß nicht mit der Tür ins Haus fallen. So lautet das oberste Gebot bei der Neukundenakquise im Ausland.
Absichten darlegen.
Die meisten Geschäftspartner:innen haben genauso wie das Unternehmen selbst das Ziel, zum Vorteil für beide Seiten ein Geschäft abzuschließen. Wer offen seine Absichten formuliert und erläutert, warum er wie agiert, verschafft sich Pluspunkte.
Flexibel zeigen.
Clevere Unternehmer:innen verhalten sich nicht wie von zu Hause gewohnt. Sie passen sich bewusst der Kultur ihres Gegenübers an – ohne zu übertreiben.
Persönliche Beziehung aufbauen.
Privates darf im Ausland auch schon mal mit Geschäftlichem verknüpft werden. Wichtig ist es, eine persönliche Beziehung aufzubauen, bevor es in die knallharte Verhandlung geht.
Strategisch vorgehen.
Unternehmen sollten sich einen Plan erstellen, wie die Verhandlungen zu führen sind. Genauso gehen schließlich auch die Partnerschaften im Ausland vor.
Rabatt einplanen.
Mit drei Prozent Skonto geben sich nicht alle Geschäftspartner:innen zufrieden. Feilschen gehört in manchen Ländern zum Geschäft. Bei der Kalkulation des Auftrages sollte also ein entsprechender Rabatt bereits einberechnet werden. Es gibt den Kund:innen ein Erfolgserlebnis, wenn sie einen hohen Nachlass aushandeln konnten.
Die Sache mit Compliance.
Mit Präsenten sollten Sie ohnehin sensibel umgehen – Stichwort „Compliance“. Im Ausland gelten keine anderen Regeln als im Inland. Aufmerksamkeiten erhalten die Freundschaft, teure Geschenke sind tabu.
In Russland beispielsweise kommen Geschenke gut an – Pralinen, auch Alkohol oder Blumen gehen immer. Russ:innen verschenken aber gerne Cognacflaschen im Wert von mitunter 200 Dollar. Zurückweisen ist vielleicht die beste Lösung, könnte aber die Spender:innen beleidigen. Beekes: „Sie sollten klar kommunizieren, warum Sie das tun, nicht einfach nur ablehnen. Kennt Ihr Gegenüber die Gründe, kann er diese akzeptieren.
Um für solche Situationen gewappnet zu sein, sollten im Unternehmen klare Regeln gelten, wie Mitarbeitende mit Präsenten umgehen.
Geschäftsessen bricht das Eis.
Das gilt auch für angemessene Kosten für ein ortsübliches Geschäftsessen. „Geschäftsessen sind und bleiben eine ideale Möglichkeit, den anderen kennenzulernen“, sagt Beekes.
Wichtig dabei: pünktlich sein. Wird von russischen Geschäftspartner:innen etwa Wodka angeboten, sollten Antialkoholiker:innen eine glaubwürdige Ausrede parat haben, zum Beispiel medizinische Gründe. Und nicht zuletzt: Frauen zahlen nie die Rechnung. Das übernehmen besser unauffällig andere Mitarbeitende.